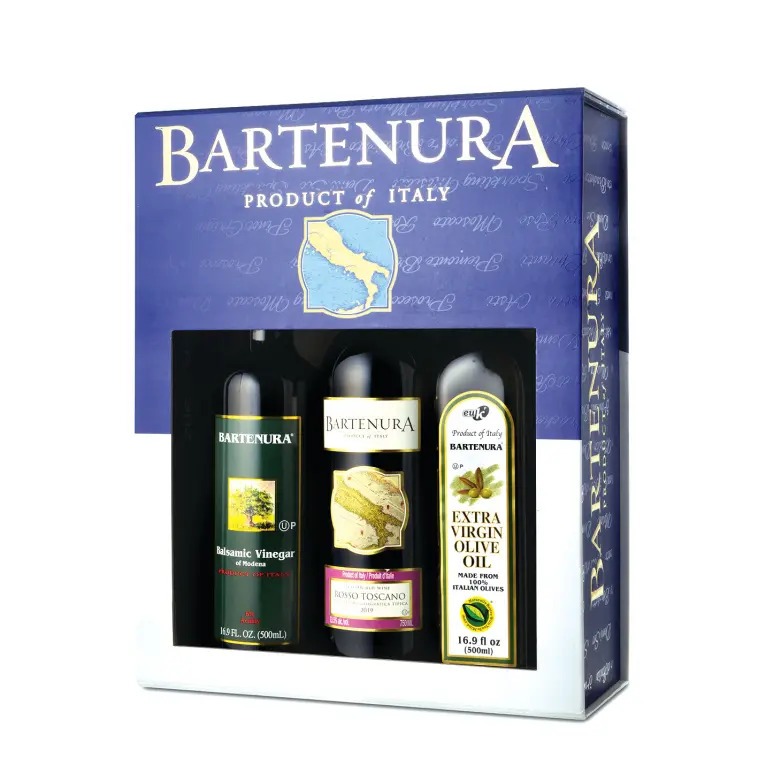זילוף שמן זית או חומץ בלסמי מעניק למנה טעם נהדר, אבל עלול להשאיר לכלוך דביק על הבקבוק ועל האצבעות. מעכשיו תוכלו לתבל את הארוחות שלכם בקלות… | Instagram

Amazon.com: מארז מתנה מגוון של Kouzini - שמן זית כתית יוונית וחומץ בלסמי, 3 חומץ בלסמי עם 2 בקבוקי שמן זית יווני, מילוי בקבוק שמן בישול נהדר, 60 מ"ל, חבילה של 5 :

Amazon.com: מארז מתנה מגוון של Kouzini - שמן זית כתית יוונית וחומץ בלסמי, 3 חומץ בלסמי עם 2 בקבוקי שמן זית יווני, מילוי בקבוק שמן בישול נהדר, 60 מ"ל, חבילה של 5 :